Soja ist aus der Agrarindustrie nicht wegzudenken und auch in unserer Ernährung allgegenwärtig. Weniger in Form von Tofu oder Sojamilch, sondern vielmehr in Form von Öl und als proteinreiches Tierfutter in der Fleischerzeugung. In den vergangenen fünfzig Jahren wurde die Produktion um das Zehnfache gesteigert. Der Historiker Matthew Roth hat in seinem Buch "Magic Bean: The Rise of Soy in America" (2018) den Aufstieg der Bohne zum wichtigsten globalen Agrarrohstoff nachverfolgt. Auf Einladung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften war er kürzlich bei der Tagung "Soja im Anthropozän" in Wien zu Gast.

STANDARD: Der Sojahandel wird oft als globales Netzwerk beschrieben, die Bohne selbst gilt als Symbol für eine globalisierte Agrarindustrie samt enormen Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Wo ist da die Magie der Sojabohne, Bezug nehmend auf den Titel Ihres Buches?
Roth: Da steckt ein wenig Ironie drin. Seit Soja Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA Fuß fasste, gab es einen Hype darum, es wurde in den Himmel gelobt. Ich habe dieses Bild der magischen Bohne hinterfragt – denn die Saaten, die wir heute haben, beruhen auf viel Arbeit. In Japan und China wurde Soja über Tausende von Jahren von einer reizlosen Kletterpflanze zu einer robusten Bohne gezüchtet. Um es zur wichtigsten Feldfrucht Amerikas zu transformieren und verwerten zu können, brauchte es einen gewaltigen Aufwand an Investitionen und Forschung. Mein Buch zeichnet diese Entwicklung in den USA im vergangenen Jahrhundert nach.
STANDARD: Was waren die wichtigsten Entwicklungsschritte im globalen Sojahandel?
Roth: Eine wichtige Entwicklung startete in den frühen 1970er-Jahren mit dem Aufstieg der südamerikanischen Produzenten, hauptsächlich Brasilien, als wichtigste Exporteure. Der Anteil der USA, die vorher führend am Exportmarkt waren, ist dementsprechend stetig gesunken. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war in den USA der einheimische Gebrauch für Tierfutter, speziell für Schweine und Geflügel, Treiber dafür, dass ein hocheffizientes System entstand, das andere Länder adaptieren konnten, als ihr Lebensstandard stieg. Das und das Aufkommen der Massentierhaltung trieben das Wachstum des Sojamarktes in der Nachkriegszeit global an.
Europa und Japan waren damals die wichtigsten Sojaimporteure – ein Anzeichen für den steigenden Fleischkonsum. 1973 erließ die amerikanische Regierung ein Embargo auf Sojaexporte, wodurch sich Importeure wie Japan an Brasilien wandten. Das war ein entscheidender Moment, der langfristige Verschiebungen mit sich brachte. Eine zweite Entwicklung setzte in den 1990ern ein. Seitdem ist China größter Sojaimporteur. Der Anteil, den China selbst für Sojalebensmittel produziert, bleibt stabil, der Anteil, der in Fleischproduktion geht, schießt hingegen in die Höhe. In den letzten Jahren hat sich die Situation verschärft durch den Handelskrieg von Ex-Präsident Trump: Die Chinesen rächten sich, indem sie Sojaimporte kürzten.
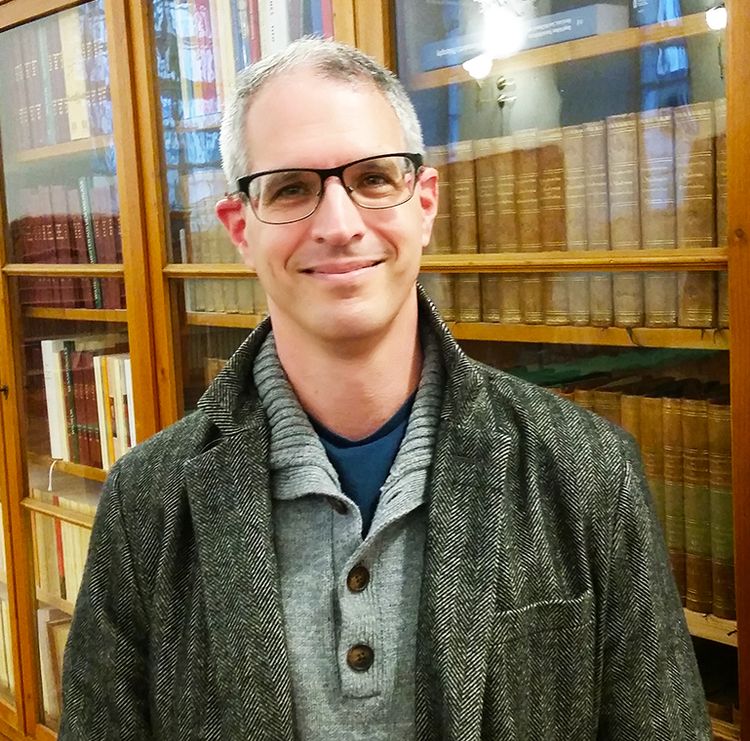
STANDARD: Sie haben sich umfassend mit historischen Details in der Sojageschichte beschäftigt, etwa der Rolle der Hippie-Gegenkultur bei der Popularisierung von Sojalebensmitteln. Wo liegen die Wurzeln dafür?
Roth: Die Explosion der Popularität von Sojanahrungsmitteln in den 1970er-Jahren hatte verschiedene Wurzeln. Zum einen waren Tofu-Shops sehr präsent in der Hippie-Metropole San Francisco und anderen Teilen Kaliforniens, wo es seit jeher eine große asiatische Community gab. Eine andere Wurzel der Sojabewegung liegt in der religiösen Gruppe der Siebenten-Tags-Adventisten. Viele ihrer Anhänger praktizieren Vegetarismus. Im frühen 20. Jahrhundert errichteten sie Unis, Colleges und Sanatorien und, um die zu versorgen, eigene Nahrungsmittelfabriken. Dort wurden Innovationen wie Veggieburger und andere Lebensmittel auf Soja- und Weizenbasis für den westlichen Geschmack entwickelt. Frühe Mitglieder der Sojabewegung berichteten, dass sie Sojamilch zuerst von den Adventisten bekommen hatten. Aber letztlich profitierte die Sojabewegung auch von der industriellen Mainstreamproduktion der Bohne.
STANDARD: Wie ist das zu verstehen?
Roth: Soja war schon damals eine Pflanze, die in weiten Teilen der USA angebaut wurde. Eine Gruppe aus San Francisco rund um die Hippie-Ikone Stephen Gaskin fuhr in einer Karawane nach Tennessee, ließ sich dort nieder und lebte in ihren Bussen auf einem Stück Land, das "Die Farm" genannt wurde, und lernten von den Nachbarn, wie man Sojabohnen anbaute – weil alle Nachbarn es machten. Sie wurden zu einer der einflussreichsten Gruppen, die Tofu, Tempeh und andere Sojaprodukte popularisierten. Also war auch die Tatsache, dass die Hippies einfach lernen konnten, Soja zu pflanzen, ein Produkt all der Investitionen, um Soja für Tierfutter extrem effizient zu produzieren.
Weil Sojabohnen so billig erhältlich waren, konnten die Gegenkultur-Entrepreneure in den 70er- und 80er-Jahren ihre Tofushops aufbauen. Als manche wie "Die Farm" begannen, Biosoja anzubauen, konnten sie Saatgut passend zu den lokalen Bedingungen verwenden, weil das Landwirtschaftsministerium jahrzehntelang die Zucht gefördert hat. Kurz: Hätte der Appetit auf Fleisch nicht die Sojabohnenindustrie angetrieben, wäre die Sojabewegung, die ja eine Alternative zu Fleisch präsentiert, niemals derartig durchgestartet in den USA. Wir Historiker haben es immerzu mit Ironie zu tun.
STANDARD: Soja wird jedenfalls sehr ambivalent verhandelt: Der Anbau für die Fleischproduktion wird heftig kritisiert wegen der Auswirkungen auf Klima und Ökosysteme, auf der anderen Seite wird die Pflanze als proteinreiche Basis für eine fleischlose Ernährung gepriesen. Welche Entwicklungen sind da zu erwarten?
Roth: Die Produktion von Milch- und Fleischersatzprodukten ist immer noch auf einem Höhepunkt. Seit den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren gibt es jedoch Gegenwind von Gruppen, die diese Produkte konsumieren. Weil ein großer Teil von Soja gentechnisch modifiziert ist, hat sein Ruf gelitten, selbst wenn gentechnikfreies Soja verwendet wird. Dazu kommt die Zunahme von anderen Alternativen, besonders bei Milchimitationen aus Hafer, Mandeln und anderen Pflanzen. Auch im Bereich von Fake-Fleisch bewegen sich Unternehmen wie Beyond Burger und Impossible Burger weg von Soja und setzen auf Erbsenmehl und ähnliche Alternativen. Wenn wir uns in Richtung einer fleischlosen Welt wandeln, würde die Sojaproduktion sinken, denn man braucht weit weniger Soja für den direkten Konsum als für Tierfutter – etwa um den Faktor zehn.
STANDARD: Hat Ihre Forschung Ihre Ernährungsgewohnheiten beeinflusst?
Roth: Ich war schon Vegetarier, bevor ich mit der Forschung zur Sojabohne begann. Das entfachte auch das Interesse an dem Thema. Ich wollte wissen: Woher kommt der Tofu, wie sind die Zusammenhänge mit der Fleischproduktion? Ich esse immer noch Tofu und Veggieburger. Seit ich Kinder habe, bin ich auch wieder zu regulärer Milch übergegangen. Meine persönlichen Vorlieben sind aber bestehen geblieben. (Karin Krichmayr, 18.11.2021)