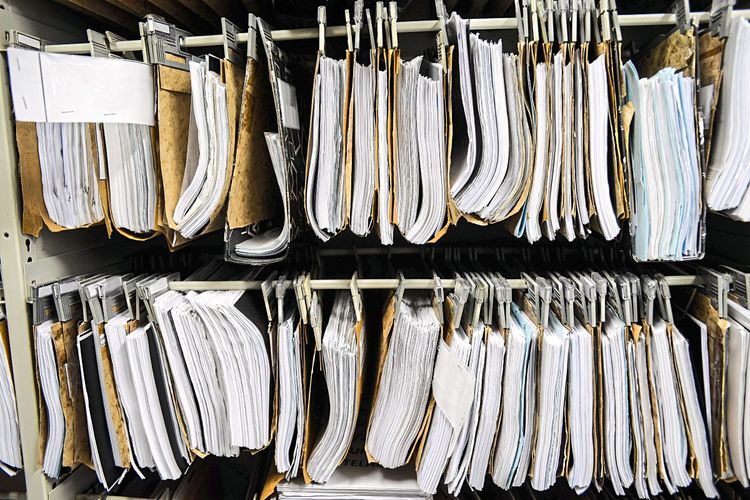
Warum die Abschaffung des Amtsgeheimnisses vor allem in Gemeinden mit weniger als 10.000 Bewohnerinnen und Bewohnern auf Ablehnung stößt, brachte am Donnerstag eine Befragung betroffener Bürgermeister im ORF-"Morgenjournal" zutage. "Wir sind insgesamt nur sieben Gemeindebedienstete", sagte Matthias Krenn, FPÖ-Bürgermeister der Kärntner Gemeinde Bad Kleinkirchheim.
Bis dato habe man "die Protokolle der Gemeinderatssitzungen und zweimal im Jahr Grundstücksumwidmungen" online gestellt. Bei voller Informationsfreiheit werde sich die Frage stellen, welche Information öffentlich sein müsse und welche nicht. Auch das "Schwärzen von persönlichen Daten wie zum Beispiel Adressen" werde viel Arbeit bereiten, sagte Krenn.
Anders Franz Mold (ÖVP), Bürgermeister der niederösterreichischen Stadtgemeinde Zwettl. Mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern könne sich die Zwettler Verwaltung "eine gegliederte Verwaltung, einen Stadtamtsdirektor und einen Juristen" leisten. Kleinere Gemeinde "mit insgesamt im Durchschnitt nicht mehr als zwei bis drei Mitarbeitern" würden nach einem kompletten Fall des Amtsgeheimnisses vor Überlastung stehen.
"Arbeitsentwurf" regt auf
Anlass der Aufregung war ein Bericht am Mittwoch über einen "Arbeitsentwurf" zum lange geplanten Informationsfreiheitsgesetz, das der heimischen Besonderheit der Amtsverschwiegenheit ein Ende setzen soll. Demnach sollen sämtliche Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern von einer automatischen Informationspflicht ausgenommen werden. Nur 87 der insgesamt 2.093 Kommunen kämen somit in die Pflicht.
"Lieber wäre uns, wenn die Gemeinden generell nicht von dieser proaktiven Veröffentlichungspflicht erfasst wären." Walter Leiss, Gemeindebund-Vertreter
Die Folge war erst einmal Verwirrung. Denn offen schien zunächst, ob damit die kleineren Gemeinden von sämtlichen vorgesehenen Regelungen befreit würden. Das dementiert Sigrid Maurer, Klubchefin der Grünen, aber entschieden: Mit dem Grundrecht auf Information werde das Amtsgeheimnis für Bund, Länder und sämtliche Gemeinden abgeschafft – unabhängig von der Größe. Soll heißen: Wer Auskunft über Angelegenheiten von allgemeiner Relevanz verlangt, den darf eine Behörde nicht mehr mit Hinweis auf das Amtsgeheimnis abblitzen lassen.
Doch zur Debatte steht auch eine Verpflichtung für die staatlichen Stellen, "proaktiv" – also ohne konkretes Bürgeransuchen – bestimmte Unterlagen und Informationen zu veröffentlichen. Genau da setzt der Arbeitsentwurf, der mit Juni 2023 datieren soll, an: Allen Gemeinden unter der 10.000-Einwohner-Grenze würde es freistehen, Bürgerinnen und Bürger "nach Maßgabe" zu unterrichten. Dazu gezwungen wären sie hingegen nicht.
Für die Vertreter der Gemeinden wäre das zweifellos ein Erfolg, machten sie doch von Anfang an gegen das Informationsfreiheitsgesetz mobil. Die Pflicht zur Auskunft würde vor allem kleinere Orte überfordern, so die Warnung, das gelte auch für die proaktive Information: Schließlich sei die Entscheidung, was veröffentlicht werden darf und was nicht, juristisch keinesfalls trivial. Am liebsten würde er dieses Gebot für sämtliche Gemeinden streichen, sagt Gemeindebund-Generalsekretär Walter Leiss. Aber wenn schon, dann sei eine Beschränkung, wie sie nun zur Diskussion steht, "vertretbar".
Türkiser Widerstand
Der Widerstand entfaltet vor allem in der ÖVP Wirkung, schließlich stellt sie von allen Parteien die meisten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Aber auch die Grünen signalisieren ein gewisses Verständnis für die Nöte der kleinen Gemeinden. Das bedeute jedoch nicht, dass das 10.000-Einwohner-Limit akkordiert sei, heißt es – vielmehr werde weiter verhandelt. In den nächsten Wochen sei mit einem fertigen Entwurf zu rechnen.
Man befinde sich "in den letzten Zügen", lässt Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), die sich bei den Grünen den Ruf der verlässlichen Verbündeten erworben hat, wissen. Es sei der Koalition ein großes Anliegen gewesen, Bedenken ernst zu nehmen, heißt es aus ihrem Büro. Nichtsdestotrotz werde mit der Abschaffung des Amtsgeheimnisses ein "wahrer Paradigmenwechsel" stattfinden.
Ob eine mögliche Abmilderung da nicht vernachlässigbar ist? Mathias Huter vom Forum Informationsfreiheit sieht das keinesfalls so. Für ihn ist die aktive Veröffentlichungspflicht der Kern der Informationsfreiheit. Ohne dieses Gebot würden Bürgerinnen und Bürger von Bauprojekten und anderen Vorhaben ihrer Gemeinde oft viel zu spät erfahren, um Kontrolle walten lassen zu können.
Ganz Europa zeigt, was möglich ist
Und selbst wenn Neugierige spitzkriegen würden, wonach sie fragen müssen: Den Gemeindechefs böten sich auf diesem Weg mehr Möglichkeiten, Ansuchen unter Hinweis auf Datenschutz oder andere Vorwände abzuschmettern. Wer sich in der Folge beim Verwaltungsgericht beschwere, müsse mit einer Bearbeitungsdauer von einem halben Jahr aufwärts rechnen. Bis da eine Entscheidung falle, sagt Huter, sei ein umstrittenes Bauvorhaben mitunter längst durchgezogen.
Er wolle die Sorgen der Gemeinden nicht einfach vom Tisch wischen, fügt der NGO-Vertreter an, natürlich entstehe da ein gewisser Aufwand. Doch es gäbe Möglichkeiten der Hilfe – etwa eine zentrale Anlaufstelle zur Klärung der rechtlichen Fragen. Dass Gemeinden unter einer Informationspflicht nicht zusammenbrechen müssten, würden praktisch alle anderen europäischen Staaten beweisen – angefangen bei Albanien und Armenien. (Irene Brickner, Gerald John, David Krutzler, 13.9.2023)