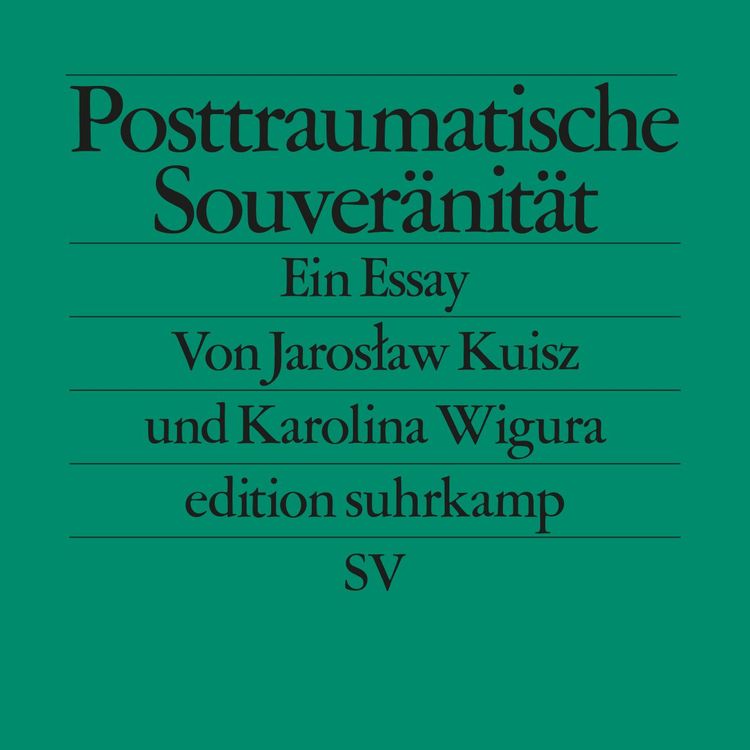Viel ist schon geschrieben worden über den Angriffskrieg, den Russland vor zwei Jahren gegen die Ukraine entfesselt hat. Dass die ostmitteleuropäischen Länder in diesem Konflikt nicht nur im geografischen Sinn eine exponierte Rolle einnehmen, kommt dabei aber bisweilen zu kurz. Vor allem dann, wenn es vorrangig um das Verhältnis zwischen Moskau und dem "Westen" geht: um das Erbe des Kalten Kriegs und das erneute Kräftemessen zwischen den Kontrahenten in der einstigen bipolaren Welt, die 1991 mit dem Ende der Sowjetunion überwunden schien.
Genau hier haben der Historiker und Politik-Analyst Jarosław Kuisz und die Soziologin Karolina Wigura mit ihrem Buch Posttraumatische Souveränität eine Lücke gefüllt. Dass beide aus Polen kommen, ist dabei ein selbstverständliches, tragendes Fundament ihres Gedankengebäudes, doch keinesfalls eine trotzig gehisste Fahne auf dem Dach: Auch dort, wo der Text mangelndes Verständnis des Westens für Ostmitteleuropa beschreibt oder das weiterhin verbreitete Klischee, die Region müsse gegenüber dem Westen noch "aufholen", wahren Kuisz und Wigura mühelos die analytische Distanz. Mit dem titelgebenden Begriff wird auf das kollektive Trauma jener Staaten hingewiesen, die allzu oft zwischen die Mühlräder der Großmächte gekommen sind – bis hin zur völligen Auslöschung: Polen etwa, die baltischen Staaten, oder die ehemalige Tschechoslowakei, die mit dem Münchner Abkommen 1938 zerschlagen und Hitlers Machthunger preisgegeben wurde.
Für sie alle ist Souveränität keine Selbstverständlichkeit. Erlittene Traumata versetzen sie in die Lage, einen scharfen, neuerdings immer seltener unterschätzten Blick auf die Prozesshaftigkeit imperialer Machtgelüste zu werfen. Kuisz und Wigura leuchten aus, was dabei zutage kommt – präzise, facettenreich und mit einigen Anleihen aus Philosophie und Traumapsychologie. (Gerald Schubert, 23.2.2024)