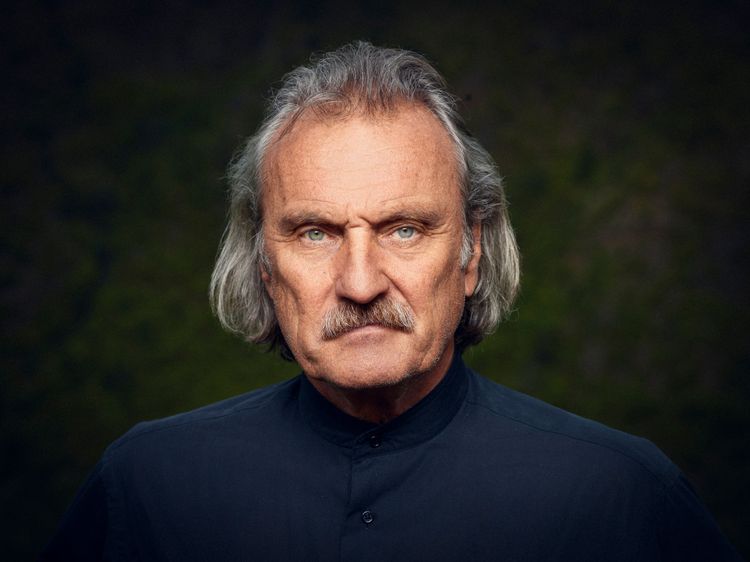
Dass Autoren selbst Auswahlbände ihrer Werke zusammenstellen, kommt eher selten vor. Alfred Polgar hat es mehr als einmal getan – er hat gerne aus zurückliegenden Publikationen einen neuen Band gemacht, schließlich schafft eine wohlüberlegte Zusammenstellung alter Texte immer auch einen neuen Kontext. Nicht zufällig im Jahr seines 70. Geburtstages zieht auch Christoph Ransmayr auf diese Art Zwischenbilanz. 1997 hat er eine Reihe begonnen, der er den Namen "Spielformen des Erzählens" gab. Der nunmehr 13. Band ruft gleichsam Texte der ersten zwölf Bände wieder auf, und um in der mathematischen Folge zu bleiben, sind es auch 13 Erzählungen, die einen neuen Rahmen erhalten haben. Aber sind es wirklich 13?
Das Inhaltsverzeichnis beschert uns eine etwas relativierende Zählung, denn auf die zwölfte Geschichte folgt als letzte nicht die 13., sondern eine, die mit 12a nummeriert ist. Wäre sie ein Unglücksbringer? Ransmayr verweist auf eine Wiener Besonderheit: Dort wurde in den Mietshäusern der Gründerzeit der schwarzen Magie der Dreizehn ausgewichen, indem die Tür 13 mit 12a gekennzeichnet wurde. Auch Ransmayrs Wiener Wohnung hat eine solche Türnummer. Das habe ihn, grübelt Ransmayr, bei Reisen nach Tibet oder Kambodscha vor den Dämonen der jeweiligen Landstriche bewahrt.
Literarischer Aberglaube
Nun hängt "erzählen" etymologisch mit "zählen" zusammen, indem es ursprünglich ja "aufzählen" bedeutet hat – wäre damit tatsächlich ein Unglück verbunden, dürfte kein Roman ein 13. Kapitel, keine Ballade eine 13. Strophe haben. Apropos: Erzählen ist bei Ransmayr eine Form, die über Gattungsgrenzen hinausgeht. Eine Erzählung könne sich in "grenzenloser Vielfalt" äußern – als Rede oder Ballade, als Drama oder Bildergeschichte oder als autobiografisches Bekenntnis. Die Zahl 12a bezeichnet dann nicht den Aberglauben, sondern steht "für die Unmöglichkeit (…), die Vielzahl der Erzählformen auch nur annähernd zu bestimmen".
Diese erzählerische Vielfalt hat Ransmayr durchaus experimentierend in seiner "Spielformen"-Reihe jedes Mal aufs Neue unter Beweis gestellt. Der zuletzt 2022 erschienene Band Unter einem Zuckerhimmel versammelt "Balladen und Gedichte", einmal waren es "Tiraden", das andere Mal "Elf Ansprachen" oder ein "Verhör". Im Jahr 2011 war es gar die Form des "Duetts": drei Reportagen, die er gemeinsam mit Martin Pollack verfasst hat, sozusagen vierhändig geschriebene Erzählungen, eine seltene Kostbarkeit.
Was uns Ransmayr mit den "Spielformen" zeigt, ist die poetische Urkraft des Erzählens, die allen Gattungen zugrunde liegt. Sie erhebt sich über die allzu engen Grenzen hinweg, die die Literaturwissenschaft setzt. Wie weit ist Erzählen überhaupt fassbar? Wäre eine Welt ohne Erzählung denkbar? Man darf sie getrost als Urstoff des Seins bezeichnen, und es wurde erzählt, lange bevor es überhaupt Schrift gab, denn zum Menschsein gehören die Mythen.

Unbeschwerte Kindertage
Als ich noch unsterblich war heißt, geradezu verbindlich, die Titelerzählung. In ihr erinnert sich Ransmayr an unbeschwerte Kindertage, noch ohne das Bewusstsein der Endlichkeit. Die Erzählung ist eigentlich eine "Ansprache", sie wurde im Oktober 2013 zur Eröffnung eines Literaturfestivals in Basel gehalten. Literaturkennern wird sofort ein ähnlicher Titel in den Sinn kommen: Als ich sterblich war, eine Erzählung Javier Marías’, die 1999 erstmals auf Deutsch erschien. In ihr blickt ein "Gespenst" auf sein vergangenes Leben zurück. Bei Ransmayr indes erzählt kein Toter, bei ihm ist Kindheit die Zeit, wo "der Tod nur ein Rätsel" ist. Obwohl die Erfahrung von Begräbnissen, der Anblick aufgebahrter Toter dazugehörte, erschien alles "märchenhaft". Und vielleicht liegt schon in den ersten Jahren, im noch "kindlichen Analphabeten" der Keim zum späteren Erzähler – die sprachliche Entwicklung beginnt am "Porzellanstrand" beim wort- und bilderzeugenden Verzehr der Buchstabensuppe und ist nicht zuletzt in der Person der Mutter aufgehoben. Die schärfte dem Kind ein: "Es liegt an dir. Du hast mit einem Löffel voll Buchstaben dein Leben, die Welt in der Hand."
STANDARD: Herr Ransmayr, ist es so? Verleiht einem das Schreiben diese Macht?
Ransmayr: Mit dem Schreiben eine Vorstellung von politischer, gar herrschaftlicher Macht zu verbinden wäre so kindisch wie hilflos. Die Macht,von der hier die Rede ist, ist der Zauber der Verwandlung der realen, greifbaren Welt in Sprache. Was für eine Magie, etwas Grenzenloses, das wir sehen, wenn wir vor der Brandung stehen, wovor wir uns in Stürmen zu Tode fürchten oder auf dem wir im besten Fall einfach dahinsegeln, in ein Wort mit bloß vier Buchstaben zu verwandeln: Meer. Das Meer!
STANDARD: Aber was würde es im politischen Sinn bedeuten?
Ransmayr: Wenn korrupte Volksvertreter oder Verbrecher aus der mit ihnen verschworenen Geschäftswelt Bücher verbrennen oder auf die Plakate oder Transparente einer Demonstration schießen lassen, dann möglicherweise nicht, weil Worte allein so mächtig wären, sondern weil sie sich in den Schriften, die ihnen entgegenschlagen, selbst erkennen. Und das ist für jeden Barbaren unerträglich.
STANDARD: Ihre Mutter nennen Sie "eine liebevolle, mit jahrhundertealten Märchen und Liedern vertraute Frau". Sind Mütter der Ursprung des Erzählens?
Ransmayr: Vermutlich erinnern sich die meisten von uns mit den ersten Erzählungen ihres Lebens immer auch an die Stimme der Mutter, einer legendären Großmutter oder eines anderen Menschen, der uns in der Wehrlosigkeit unserer ersten Jahre behütet und beschützt hat. Wenn meine Mutter mir in meiner frühesten, schriftlosen Zeit aus einem Buch vorlas, hatte ich keinerlei Vorstellung vom Lesen, sondern glaubte, ein Mensch müsste sich nur über dieses aufgeschlagene, aus unendlich vielen Blättern bestehende Papierding beugen und würde allein dadurch befähigt, ohne Stocken und langes Nachdenken die schönsten Geschichten zu erzählen. Lange bevor ich lesen lernte, versuchte ich diesen Zauber nachzuahmen, saß da, beugte mich über ein aufgeschlagenes Buch, Kochbuch, Märchenbuch oder Gebetbuch, las nichts, verstand nichts und murmelte vor mich hin: erzählte.
STANDARD: Das Ferne, Fremde kann aber auch eine Extremerfahrung sein, wenn ich an eines Ihrer ersten Bücher, "Die Schrecken des Eises und der Finsternis", denke.
Ransmayr: Als ich in meiner ersten größeren literarischen Arbeit von einer arktischen Expedition erzählte, die zur zufälligen Entdeckung des nördlichsten Landes der Welt, des Franz-Josef-Archipels, führte, als ich das Packeis, die Finsternis der Polarnacht und das Kreischen der Eispressungen beschrieb, war ich noch nie weiter nördlich als bis Kopenhagen gekommen. Aber als ich Jahre später, nach Fahrten nach Sibirien und Spitzbergen, an Bord eines russischen Eisbrechers die unter Gletschern begrabenen Inseln des Franz-Josef-Landes erreichte und mit einer Dose Pfefferspray gegen streunende Eisbären durch die bis dahin größte Verlassenheit meines Lebens gewandert bin, hatte ich in manchen Augenblicken das Gefühl, dieses Land mit allen seinen Lichterscheinungen und Eismauern nicht nur längst zur Sprache gebracht, sondern erfunden zu haben.
STANDARD: Ist neben der Kraft der Imagination Erzählen und Reisen eine Flucht vor der Sterblichkeit?
Ransmayr: Auch das wäre ein hoffnungsloser Ausbruchsversuch. Natürlich zeigt sich immer wieder eindrucksvoll, dass ein poetisches oder erzählerisches Werk seinen Urheber oder seine Urheberin lange und sehr lange überdauern kann. Aber der Sterblichkeit entkommen? Selbst die Werke Homers, Ovids oder der Dichter Mesopotamiens werden nur so lange Bestand haben, solange jemand da ist, der sie lesen oder archivieren kann. Und diese Zeit ist, wie ein Sonntagsastronom wie ich mit Überzeugung sagen kann, sehr begrenzt.
STANDARD: Als Ihre Mutter, die Sie als Ihre erste Lehrerin bezeichnen, starb, legte sie einen Finger auf die Lippen. Sie haben die Geste interpretiert als Verweis auf das Ungeheuerliche, Unfassbare, das Stille gebietet. Kommt das Schweigen nach dem Erzählen als der "verlorene Rest" in einem "grenzenlosen Raum"?
Ransmayr: Wer sich wie ich mit seinen Spiegelteleskopen und Refraktoren gelegentlich dem manchmal ungeheuerlichen und verstörenden, manchmal auch tröstlichen Anblick des Nachthimmels aussetzt, weiß, dass jedes mögliche Leben auf einem ein Zentralgestirn umkreisenden Planeten nur ein Blitz in der Geschichte eines Himmelskörpers sein kann. Auch unsere Terra drehte sich Milliarden von Jahren ohne uns um die Sonne – und wird nach unserem Verschwinden im Verlauf der letzten Abschnitte der Erdgeschichte wieder Milliarden von Jahren die Sonne ohne uns umkreisen. Unsere verfliegende Existenz stellt also eine unglaubliche kosmologische Kostbarkeit dar. Dass wir mit aller Kraft an unserer Selbstvernichtung und der Verwandlung selbst der wunderbarsten Möglichkeiten in ein höllisches Instrumentarium arbeiten, ist wohl eines der größten Rätsel der bekannten Welt.
STANDARD: Aber der Anspruch bleibt, mit dem Erzählen Unsterblichkeit zu schaffen?
Ransmayr: Es ist doch eine schöne Vorstellung für jeden, der sich mit dem Erzählen von Geschichten beschäftigt, dass, was immer er sagt oder schreibt, zunächst einmal von denen gehört oder gelesen wird, die sich seine Zeit und Welt mit ihm teilen. Wer braucht bei diesen Aussichten noch Unsterblichkeit? So alt wie die Menschheit kann allerhöchstens die Kunst des Erzählens selbst werden, die nach jedem Verstummen eines vermeintlich Unsterblichen mit einer neuen Stimme weiter und weiter spricht. (Gerhard Zeillinger, 16.3.2024)