
Gugulethu ist eine Township von Kapstadt, die in den 1960ern vom damaligen Apartheidregime besiedelt wurde, nachdem es begonnen hatte, das lebendige und aufmüpfige Stadtviertel District Six abzureißen. Als Mamela Nyamza 1976 in Gugulethu zur Welt kam, war dieser Umsiedlungsprozess noch in vollem Gange.
Heute ist Nyamza eine anerkannte Choreografin, Kuratorin, Aktivistin und Pädagogin etwa in Deutschland, Frankreich und Australien. Ihre Tanzkenntnisse verteilen sich über ein beachtliches Spektrum: von Ballett über modernen Tanz, Jazz, den japanischen Butō bis hin zu afrikanischen Tanzstilen, Gumboot (den südafrikanischen Gummistiefeltanz) und Pantomime. Außerdem beherrscht sie Bewegungs- und Körpertechniken wie Release, Horton und Flying Low.
Nyamza wurde in eine laute, von Musik durchdrungene Atmosphäre hineingeboren, auf die sie reagierte, indem sie den Puls ihrer Umgebung in Tanz übersetzte. Gelernt hat sie unter anderem in Südafrika, New York, London und bei Impulstanz in Wien. Nach dem Tod ihrer Mutter, verriet Nyamza der Autorin eines Buchs über afrikanischen Tanz, konnte sie sie in ihren "Träumen spüren, wie sie mir sagte, ich solle meinen Tanz nutzen, um echte Geschichten zu erzählen".
Afrikanisch, Frau, lesbisch
Ihre echte Geschichte ist, dass sie afrikanisch, eine Frau und lesbisch ist. "Als ich Diskriminierung in der Gesellschaft erfahren habe", sagt sie, "dachte ich: ,Ich bin eine Künstlerin, also werde ich die Stimme sein, die diese Themen anspricht.‘" Heute ist über sie zu lesen, ihre "ultimative Vision" sei es, "den Tanz zum Genre der Performance-Kunst zu machen, Körperpolitik zu allen sozialen Themen zu vermitteln" und, wie es heißt, "to edutain", also durch Unterhaltung zu erziehen. Ihr niederschwelliger Tanz- und Choreografiestil verbindet traditionellen mit heutigem Tanz.
Bei den Wiener Festwochen gastiert sie mit dem Stück Hatched Ensemble, das aus einer Reihe früherer Arbeiten der Nullerjahre (Hatch, Kutheni, Shift und, zusammen mit ihrem Sohn, Hatched) hervorgegangen ist. Hatched Ensemble, 2023 im südafrikanischen Makhanda uraufgeführt, gastiert jetzt im Volkstheater als Gruppenstück für neun Tänzerinnen, die sich über den Spitzenschuh hinaus in die Echtheit von Mamela Nyamzas gesellschaftlichen Themen bewegen. Mit dabei sind ein Live-Musiker, Given "Azah" Mphago, und die Opernsängerin Litho Nqai.
Volkstheater, 9. 6., 19.00 + 10. 6., 20.00
Performance-Installation "Dambudzo"
Im Jahr 2008 filmten Alla Kovgan und David Hinton eine rasante Doku über die Tänzerin Nora Chipaumire, die später auch vom TV-Sender Arte ausgestrahlt wurde. Nora zeigt, wie die 1965 im damaligen Rhodesien und heutigen Simbabwe geborene Künstlerin in die Landschaft ihrer Kindheit zurückkehrt und durch Erinnerungen an ihre Jugend reist.
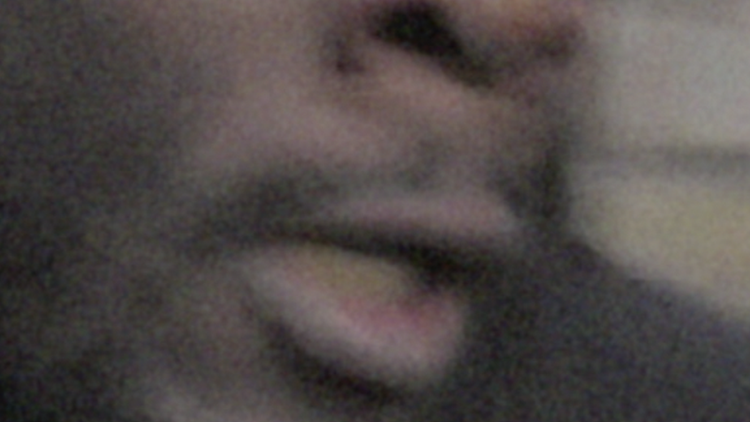
Gedreht wurde in Südafrika, zu sehen sind lokale Figuren aus Performance und Tanz, von Schulkindern bis zu Großmüttern. Aktuell lebt Chipaumire, die auch US-Staatsbürgerin ist, in Brooklyn, New York. In Simbabwe hat sie Jus studiert und in Kalifornien Tanz. Die wichtigsten künstlerischen Themen zieht sie aus ihrer Beschäftigung mit Geschlechter-, Kolonialismus- und Rassismus-Diskursen.
Bei den Wiener Festwochen zeigt Nora Chipaumire im Mumok die Uraufführung der Performance-Installation Dambudzo. Bei zwangloser Bar-Atmosphäre mit Musik wird das Publikum eingeladen, aktiv an Ideen für, wie es heißt, "neue mögliche Welten" mitzuarbeiten. Stichwort: Dekolonisierung.
Mumok, 11.–14. 6., 19.00; Installation bis 23. 6., täglich 10.00–18.00
"Rothko": Die Aura der Fälschung
Kunstfälschung – ist das nur verbrecherisch oder auch subversiv bis zuweilen komisch? Um das zu klären, kreist dieses monumentale Theaterstück über dem Werk des 1903 im heute lettischen Daugavpils geborenen und im Alter von zehn Jahren in die USA emigrierten Marcus Rothkowitz, berühmt als Mark Rothko.
Bei Rothko lässt der vielgelobte polnische Regisseur Łukasz Twarkowski sein Publikum in die Geheimnisse der Aura von Kunst eintauchen. Dabei spielt klarerweise Walter Benjamins Essayklassiker Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1935) eine Rolle. Aber Twarkowski dringt mit den Schauspielern des Dailes Theatre aus Riga noch weiter vor: in die teilweise toxischen Kanäle des Kunstbusiness.

Spekulation, Gier und kriminelle Energie spielen in diesem Wirtschaftszweig, der die bemühten ethischen Ansprüche der gegenwärtigen bildenden Kunst konterkariert, ebenso eine Rolle wie die Lust, dieses Monster durch Fakes und Simulationen zu unterminieren. Hier wird diesem Monster ins Maul geschaut. (Helmut Ploebst, 7.6.2024)
MQ, Halle E, 21.–23. 6., 19.30