
Es ist eine tagelange Reise aus der kasachischen Steppe bis nach Leningrad, angereichert mit viel Erzählstoff: Die Hochschülerin Lina leistet ihren Arbeitsdienst in einer weit abgelegenen Sowchose, als sie die Nachricht erreicht: "Vater schwer krank. Komm rasch!" Bis ins heimatliche Leningrad sind es viertausend Kilometer, die Verkehrsverbindungen sind schlecht, allein die nächste Bahnstation ist mehr als hundert Kilometer entfernt. Vielleich, so wird Lina gesagt, nehme sie ein Lastwagen mit: "Übermorgen. Morgen. Vielleicht auch in einer Woche. Oder noch später." Immer wieder gibt es Unterbrechungen, Hindernisse, Verzögerungen.
Für den Leser ist es dennoch eine kurzweilige Reise. Sie bildet den Rahmen für einen Roman mit vielen Geschichten, die ein bedrückendes wie kafkaeskes Zeitgemälde formen, und sie liefert ein Erklärungsmuster des "real existierenden Sozialismus", in dem vieles irreal anmutet. In der ihnen verordneten zeitlosen Wirklichkeit haben die Menschen "keine Vergangenheit" zu haben, der Anspruch lautet, "nur sowjetisch und nichts weiter" zu sein. Doch der "neue Sowjetmensch" kommt nur schwer damit zurecht.
Narrativer Umweg
Von Beginn an ist der Roadtrip durch vier Zeitzonen ein narrativer Umweg, der uns zur Geschichte von Linas jüdischer Familie führen soll: Im Zweiten Weltkrieg haben sie die Blockade von Leningrad überlebt, danach waren sie für die Deportation in die Steppe vorgesehen, wäre nicht Stalin im richtigen Augenblick gestorben. Der Arbeitsdienst hat Lina trotzdem dorthin geführt, der Weg zurück ist lang, und neue Erzählungen lenken sie immer wieder von der Sorge ab, ob sie den Vater noch lebend antreffen wird.
Aus Lina spricht die Stimme von Vertlibs Mutter, einer kämpferischen jungen Frau, die sich über ihr Leben in der sowjetischen Illusion erst klarwerden muss. Immerhin ist sie Teil einer stark fragmentierten multiethnischen Gesellschaft, die vom Diktat der Partei, von Russifizierung und dem immer noch stalinistischen Geist zusammengehalten wird.
Wie bunt, wie widersprüchlich diese Gesellschaft ist, zeigt Vertlib am Beispiel der zweiten Frauengestalt im Roman: Greta, "eine schlitzäugige Deutsche in Kasachstan". Ihre Mutter ist eine verbannte Volksdeutsche, ihr leiblicher Vater ein Kirgise, sie selbst das Produkt einer Vergewaltigung. Mit nichtrussischer Herkunft, das gilt auch für Lina, ist man in diesem Land verdächtig und jederzeit Repressalien ausgesetzt. Kein Wunder, dass nach Greta bereits gefahndet wird: Sie ist aus einer Kolchose geflüchtet und mit einem Ausweis unterwegs, der einer Toten gehört. Ihre Lebensgeschichte, die sie Stück für Stück erzählt, ist so intensiv und ausladend, dass man in ihr die eigentliche Protagonistin vermuten könnte. Ein erzählerischer Trick, der Lina als Zuhörerin nur noch mehr ins Zentrum rückt.
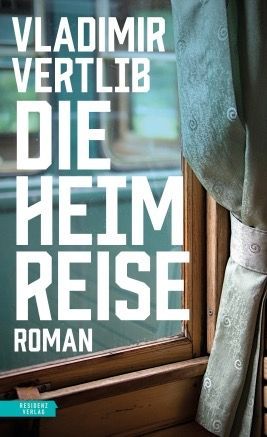
Aber kann man glauben, was da erzählt wird? Wer sagt, dass diese Greta nicht in Wahrheit eine KGB-Agentin ist, eine Provokateurin, die Lina aushorchen will? Manchmal erscheint sie Lina wie eine Verrückte, auch wenn sie nur das will, was alle wollen, sich in Russland aber niemand traut: "Ich möchte ich sein." Und Lina? Geduldig hört sie zu, auch wenn sie sich nach einer ganz anderen Erzählung, nämlich danach sehnt, noch ein paar Stunden mit ihrem Vater verbringen und ihm zuhören zu können, mehr von seinem Leben und dessen Beschwernissen zu erfahren.
Denn in der Sowjetgesellschaft ist man nicht nur dem Schicksal, man ist in erster Linie der Willkür der Partei ausgeliefert. Ständig geistern Begriffe wie Verhaftung, Deportation, Kollektivierung durch die Erzählung, von Denunzianten, Kommissaren, von Sperrgebiet oder Hunger ist die Rede. Auf der Straße sieht man Aufschriften wie "Schlagt die Juden tot, rettet Russland". Über Atomunfälle wird gemunkelt, die offiziell nie stattgefunden haben, und von verbotener Literatur in Koffern wird heimlich erzählt. Auch Lina muss aufpassen, nichts Unbedachtes zu sagen, obwohl sie noch jung genug ist, um "an den Sieg des Sozialismus und an eine märchenhafte kommunistische Zukunft mit Wohlstand und Glück für alle" zu glauben. Da will man nicht ins Grübeln kommen: "Sei nicht so kompliziert", antwortet sie ihrer Reisebegleiterin. "Unser Leben ist viel zu schwer für existenzielle Fragen."
Anschaulicher könnte man die sowjetische Unerträglichkeit des Seins nicht nachzeichnen. Dem Sowjetmenschen als staatlich gelenkter Verfügungsmasse bleibt nur, sich durch Verschweigen und Verzerren mit dieser Wirklichkeit zu arrangieren. Es ist ein Kunstgriff des Autors, wenn er Lina auf ihrer Reise auf eine Theatergruppe treffen lässt – diese symbolisiert den einzigen Freiraum und verweist auf ein Motiv, das wir aus der deutschen Literatur bei Goethe, Eichendorff oder Storm kennen. Wo immer der Protagonist einer Theatertruppe begegnet, ist eine Sehnsucht nach einem anderen Leben spürbar. Im Theater kreuzen sich Wirklichkeit und Fiktion. Genau diese Verbindung – zwischen Familienbiografie und erzählter Geschichte – ist Vertlib in diesem Roman gelungen.(Gerhard Zeillinger, 15.6.2024)