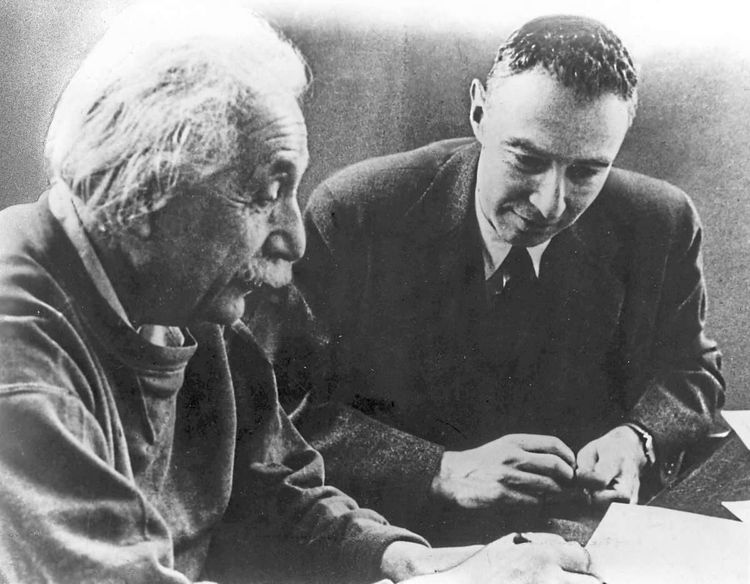
Eines der erstaunlichsten Zeitdokumente der Wissenschaftsgeschichte kommt nun unter den Hammer. Im Jahr 1939 schrieb Albert Einstein auf Drängen seines Physikerkollegen Leó Szilárd zwei Briefe. Er warnte darin den damaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt vor einer mächtigen neuen Technologie: Mithilfe der erst kürzlich entdeckten Spaltung von Atomkernen ließen sich riesige Energiemengen freisetzen. "Es könnte möglich sein, in einer großen Menge von Uran eine nukleare Kettenreaktion in Gang zu setzen", schreibt Einstein, "und dieses neue Phänomen würde auch zur Konstruktion von Bomben führen."
Einstein war aufgefallen, dass Deutschland den Verkauf von Uran eingestellt hatte, und er befürchtete, dass das Land begann, das Material für eine mögliche Entwicklung von Kernwaffen zu horten. Zwar gab es in Wirklichkeit kein ernstzunehmendes deutsches Atomwaffenprogramm, doch Einstein hatte weniger als einen Monat vor dem deutschen Angriff auf Polen bereits die Waffen im Blick, die letztlich das Kriegsende besiegeln würden.
Zwei Briefe
Einstein setzte seine Unterschrift unter zwei Dokumente. Die beiden Physiker waren sich nicht sicher, mit welcher Aufmerksamkeitsspanne sie beim Präsidenten rechnen durften, und erstellten eine Lang- und eine Kurzversion, die Einstein beide signierte. Man entschied sich letztlich, die Langversion an Roosevelt zu schicken. Sie befindet sich heute in der Roosevelt-Bibliothek in New York. Das kürzere, nicht zum Einsatz gekommene Dokument war zuletzt im Besitz des 2018 verstorbenen Microsoft-Mitbegründers Paul Allen, der es im Jahr 2002 für etwas über zwei Millionen Dollar erworben hatte. Allen sammelte unter anderem Kunst und historische Computertechnologie. 2022 wurde mit der Versteigerung der Exponate begonnen. Der Erlös kommt, wie von Allen gewünscht, wohltätigen Zwecken zugute.
Nun wird auch der Einstein-Brief versteigert. Die Auktion soll im September stattfinden und wird vom Auktionshaus Christie's durchgeführt. Der Schätzwert beträgt vier Millionen Dollar, rund 3,74 Millionen Euro. Darüber berichtet nun das US-amerikanische Wall Street Journal. Immer wieder landen Briefe oder Manuskripte Albert Einsteins bei Auktionen. Im Jahr 2021 wurde ein handschriftliches Manuskript zur Relativitätstheorie aus den Jahren 1913 und 1914 für 11,6 Millionen Euro verkauft. Ein Brief, in dem Einstein über Gott philosophiert, wechselte im Jahr 2018 für 2,6 Millionen Euro den Besitzer.

Warnung mit geringen Folgen
Ein direkter Startschuss für das später vom Regisseur Christopher Nolan Oscar-gekrönt in Szene gesetzte US-Atomwaffenprojekt war der Brief nicht. Roosevelt antwortete unverbindlich, stellte aber ein Expertengremium zusammen, das der erste Vorläufer des späteren Manhattan-Programms zum Bau der Atombombe war. Einstein war auch nicht der Einzige, der die Amerikaner warnte. Das hatten zwei deutsche Physiker bereits Monate zuvor getan.
Die Initiative für den Brief ging nicht von Einstein selbst aus. Es waren Physikerkollegen, die ihn überredeten, sein Gewicht als bedeutender Forscher zu nutzen. Während die Geschichte von Leó Szilárds Einfluss auf Einstein gut bekannt ist, gab es weitere, weniger bekannte Versuche, Einstein für eine Warnung an die US-Regierung zu gewinnen.
Auch der Wiener Physiker Hans Thirring machte sich Sorgen, Deutschland könnte eine Atombombe entwickeln. Weil Thirring in Wien war, konnte er den in Princeton ansässigen Einstein nicht erreichen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Es gelang ihm, den mit Einstein befreundeten Jahrhundertmathematiker Kurt Gödel als Überbringer der Nachricht zu gewinnen. Doch Gödels Ausreise verzögerte sich und wurde zum Spießrutenlauf. Letztlich verzichtete Gödel darauf, Einstein die Nachricht mitzuteilen, sondern richtete nur Grüße aus. Er rechtfertigte sich damit, dass er nicht glaubte, dass eine akute Gefahr bestünde. Hier täuschte sich der große Logiker. (Reinhard Kleindl, 27.6.2024)