
Erst kürzlich hatte sie wieder so einen Fall. Eine junge Frau wurde zu Eva Ornella auf die Station für Innere Medizin gebracht. Die Patientin litt unter Erbrechen und vermehrtem Durstgefühl. Sie war gerade aus Südamerika zurückgekehrt und zeigte eine Menge unklarer Symptome. Auf der Station konnte man sich keinen Reim darauf machen. So passierte, was oft passiert, wenn Frauen "unklar" erkranken. "Stellt sie dem Psychiater vor", hieß es. Solche "Lösungen" seien Alltag, erzählt die Internistin. "Es ist leider Realität in der Medizin, dass vieles, was man sich medizinisch nicht erklären kann, dann als 'psychisch' abgestempelt wird. Gerade bei Frauen." Noch immer wisse man nicht, was die Patientin hat. Ornella seufzt hinter ihrem Schreibtisch.
Die Internistin ist Gendermedizin-Beauftragte im Kärntner Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan. Erst heute hat sie einen Vortrag für die Kollegenschaft gehalten. Worum es da ging? "Darum, dass der medizinische Mensch eigentlich der medizinische Mann ist."
Als Kärnten vor drei Jahren Modellregion für Gendermedizin wurde, ist Ornellas Chef an sie herangetreten: Ob sie Genderbeauftragte im Krankenhaus werden möchte? Sie sagte zu, obwohl sie anfangs nicht sonderlich begeistert war. Sie hatte bis dahin keinerlei Berührungspunkte mit dem Thema gehabt, weder als Ärztin noch als Medizinstudentin. "Wenn ich mir meine Anatomiebücher von damals hernehme, schüttele ich jetzt nur den Kopf. Es waren ausschließlich Männer abgebildet, nirgends war eine Frau zu sehen. Außer beim Geschlecht natürlich." Doch selbst in diesem Fachbereich werde erst seit kurzem die Klitoris vollständig abgebildet, kritisiert die 40-Jährige. "Dabei ist die ein riesiges Organ."
Frauen sind keine kleinen Männer
Jahrhundertelang verstand man Frauen als kleinere Männer, mit denselben Organen und Körperfunktionen, lediglich mit dem Unterschied, dass ihre Geschlechtsorgane nach innen und nicht nach außen gestülpt sind. Heute weiß man zwar, dass Frauen langsamer verdauen und öfter pro Minute atmen als Männer. Aber man weiß auch, wie ungesehen die Frau als Patientin nach wie vor ist. Denn der Mann ist die Norm. In der Medikamentenforschung wird meistens an männlichen Probanden getestet, die durchschnittlich 70 Kilogramm wiegen und 1,75 Meter groß sind. Selbst die männliche Maus wird im Labor bevorzugt, weil sie günstiger in der Haltung ist und weniger kompliziert zu testen. Der Mäuserich hat eben keinen Zyklus.
So haben Frauen mehr Medikamentennebenwirkungen, und es gibt große Wissenslücken – den sogenannten Gender-Data-Gap. Die Wechseljahre sind ein gutes Beispiel für diesen blinden Fleck. Gendermedizin will das bewusstmachen und eine geschlechtersensible Medizin einläuten. Denn Frauen, Männer und Diversity-Gruppen erkranken verschieden, das haben zahlreiche Studien belegt. Was fehlt, ist die Umsetzung in die Praxis – oder die Awareness, wie man in Kärnten sagt.
Kärntner Pionierarbeit
Wie kommt es nun, dass ausgerechnet jenes Bundesland, das weder über eine Medizinuniversität noch über das große Geld verfügt, seit drei Jahren Pionierarbeit für die Gendermedizin leistet? Österreich hatte zwar eine Vorreiterrolle, als 2010 die weltweit erste Professur für Gendermedizin gegründet wurde, aber das war in Wien. Kurze Zeit später folgte der zweite Lehrstuhl, beachtlich für ein so ein kleines Land, allerdings in Innsbruck. Die Wissenschaft liefert laufend neue Erkenntnisse über die medizinischen Unterschiede zwischen Mann und Frau, doch eine breite Anwendung in der Praxis blieb aus.
Die vermisste auch Miriam Hufgard-Leitner, die sich als Gendermedizinerin an der Med-Uni in Wien seit langem mit dem Thema auseinandersetzt. 2021 forderte sie daher über einen politischen Antrag eine Modellregion für Gendermedizin. Zunächst tat sich nichts, erzählt sie. Dann bekam sie einen Anruf: "Ob die Modellregion auch Kärnten sein könnte?" Am Apparat war das Büro von Beate Prettner, der Landesrätin für Gesundheit in Kärnten. Es liegt also weniger am Bundesland als an der Vision zweier Frauen: einer Ärztin mit Sinn für Politik und einer Politikerin, die eigentlich Ärztin sein wollte.
Denn die Kärntner Landesrätin ist ausgebildete Allgemeinmedizinerin und Gynäkologin. Bereits 2017 hatte sie bei einer Bundesländerkonferenz der Gesundheitsräte erfolgreich einen Antrag eingereicht, um Gendermedizin verpflichtend in die Ärzte-Ausbildung aufzunehmen. Doch "etwas Handfestes" sei daraufhin nie passiert, kritisiert Prettner. "Wenn man die Daten kennt und zum Beispiel weiß, dass Frauen beim Herzinfarkt klar im Nachteil sind, weil sie andere Symptome haben, dann verstehe ich nicht, warum man diese Fakten nicht in die Realität umsetzt."
Frauen am Ruder
Und weil es in Österreich keiner tat, machte es die Landesrätin im Jahr 2021 eben selbst: Das gesamte Bundesland wurde zur Modellregion für Gendermedizin. Prettner strahlt. Ja, die Modellregion läuft. Gerade erst habe das deutsche Saarland nach dem Erfolgsrezept gefragt."Wir befanden uns damals in einer günstigen Situation", erzählt die 59-jährige SPÖ-Politikerin. "In allen Parteien waren Frauen vertreten, insbesondere im Gesundheitsausschuss, die alle das Thema mitgetragen haben, auch aus ÖVP und FPÖ. Zudem hatten wir damals die österreichweit einzige Ärztekammerpräsidentin in Kärnten, eine Herzchirurgin, die sofort die Unterstützung der Ärztekammer zusicherte."
Im Gegensatz zur politischen Zustimmung hagelte es seitens der heimischen Medien anfangs Kritik. Die Gründung der Modellregion fiel mitten in die Pandemie. Ob Prettner denn keine anderen Sorgen hätte, als sich um Gendermedizin zu kümmern, wenn die Corona-Zahlen so in die Höhe gingen, hieß es. In der Tat, der Zeitpunkt war ungünstig, gibt die Landesrätin zu. Andererseits: Politisch gebe es immer ein Thema, das wichtiger sei, als "irgendein Frauenthema".
Bei den Menschen kommt das Thema gut an. "Selbst in konservativen Kreisen kann man mit den Daten zur Herzgesundheit überzeugen", betont Hufgard-Leitner. Die Wienerin begleitet die Modellregion seit ihrer Gründung, hält Lehrveranstaltungen und Vorträge für Mediziner und Gesundheitsfachkräfte und spricht in Gemeinden auch schon mal in Festzelten. Das Kärntner Motto lautet "Frauenherzen schlagen anders", im Flyer steht: "Gendermedizin kann Leben retten."
Gendermedizin kann Leben retten
Das ist nicht übertrieben, wie man vom Herzinfarkt weiß. Er ist das besterforschte Beispiel und hat der Gendermedizin 1991 ihre wissenschaftliche Legitimität verschafft. Bis dato galt der Herzinfarkt als typische Männererkrankung: Ein Mann spürt einen stechenden Schmerz, der in den linken Arm strahlt, er greift sich ans Herz. Die Statistik bestätigt: 60 Prozent der Herzinfarkte betreffen Männer. Doch die Frauen sterben häufiger daran, jüngere Frauen sogar doppelt so oft wie Männer im selben Alter. Weil sie andere Symptome zeigen. Für Frauen typisch sind Übelkeit und Erbrechen, Schweißausbruch, plötzliche starke Schmerzen zwischen den Schulterblättern. Ein Infarkt als Ursache drängt sich da nicht auf, nicht einmal bei den Frauen selbst.
Was Konsequenzen hat, wie Internistin Ornella weiß: "Studien zeigen, dass Frauen 20 bis 30 Minuten länger in der Notaufnahme warten, weil die Symptomatik falsch eingeschätzt wird." Hinzu komme, dass der Befund von Frauen bei der klassischen Herzkathederuntersuchung oft unauffällig ausfällt. Das weibliche Herzversagen wird meist weniger durch Gefäßverkalkungen ausgelöst als beim Mann. Es entsteht eher durch Spasmen, die zu Minderdurchblutung führen. Mit einem bestimmten Test könnte man das feststellen, doch aus Zeitgründen werde darauf meist verzichtet, weiß Ornella. Man entlässt Frauen oft ohne Diagnose, das belaste die Psyche. Diese Erkenntnis sei ernüchternd, die Genderbeauftragte ist froh, sich nun darüber austauschen zu können. Denn seit März dieses Jahres nimmt sie am neuen Diplomlehrgang für Gendermedizin teil, dem ersten österreichweit.
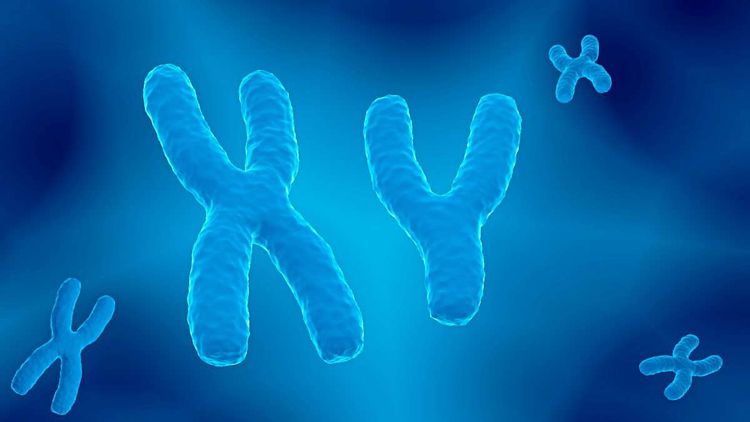
Der Lehrgang markiert einen Meilenstein für die Modellregion Kärnten. Er wird von der Gendermedizinerin Margarethe Hochleitner geleitet und von der Ärztekammer anerkannt. "Das Land finanziert 15 Kärntner Ärzten die Fortbildung", berichten Paula Dostal und Andrea Dorighi, "im Gegenzug gewinnen wir Multiplikatoren." Dostal und Dorighi leiten die extra eingerichtete Koordinationsstelle für Gendermedizin in Klagenfurt. Aus dem Nichts sei man gestartet, heute verfolge man eine klare Strategie mit drei Säulen: Kärnten bildet Ärztinnen und Pharmazeuten fort, baut Bewusstsein in der Bevölkerung auf und verankert Gendermedizin als Pflichtfach in der Ausbildung von Pflegeberufen. Kärnten hat zwar keine Medizin-Uni, aber es verfügt über eine Fachhochschule und die "GuKs" – die Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege.
Sex versus Gender
Die Unterscheidung von Sex und Gender gehört deshalb auch zum Lehrplan der GuK-Abschlussklasse in Klagenfurt. "Frauen wollen dem Hausarzt nicht auf die Nerven gehen. Das ist Gender", erklärt Miriam Hufgard-Leitner, die der Lehrveranstaltung per Video zugeschaltet ist. Die Gendermedizinerin erklärt, dass nicht nur biologische Unterschiede bei Erkrankungen eine Rolle spielen, sondern auch gesellschaftlich geprägte – und dass diese bei der medizinischen Versorgung zu beachten sind: "Wenn Frauen mit der Vereinbarkeit von Familie, Job und Haushalt kämpfen, dann hat das einen Einfluss auf ihren Herzkreislauf und ihren Diabetes."
Als Oberärztin im AKH Wien erlebt sie, wie sich die modernen Rollenansprüche bei ihren Patientinnen, vor allem bei Müttern im Beruf, gesundheitlich auswirken. "Vielleicht werden wir irgendwann beweisen, dass die Kränkung der Nichtvereinbarkeit mit dem Herztod zusammenhängt", sagt die Forscherin. Für sie birgt Gendermedizin auch eine frauenpolitische Chance: "Früher hat man die Biologie der Frau hergenommen, um ihre gesellschaftliche Minderstellung zu legitimieren. Daher war es damals im Kampf um Basics wie das Wahlrecht wichtig, jegliche biologische Unterschiede zu verdecken."
Heute sei die Situation anders. Man müsse die Biologie der Frau wieder anerkennen – mit einer anderen politischen Ableitung. Davon ist die bald dreifache Mutter überzeugt. Hufgard-Leitner ist Verfechterin für Krankheitstage bei der Regelblutung. "Die Zeiten haben sich geändert. Unsere Pionierinnen mussten noch dafür kämpfen, dass wir überhaupt operieren dürfen. Wir können jetzt sagen, wir stehen selbstverständlich im OP, aber der Arbeitsplatz muss sich den Lebenszyklen von Frauen genauso selbstverständlich anpassen."
Männer profitieren auch
Die Gendermedizin sei nicht als Geschlechterkampf zu verstehen. Das betonen alle Expertinnen. Denn Männer profitierten ebenfalls, etwa bei Krankheiten wie Osteoporose oder Depression, die als klassische Frauenthemen gelten. Es geht vielmehr darum, sich die Vorteile einer geschlechterspezifischen Gesundheitsversorgung bewusstzumachen und zu berücksichtigen – in der Erstversorgung, bei der Dosierung von Medikamenten, bei Standardprozessen im Krankenhaus.
Über das langfristige Pilotprojekt will Kärnten transparent seine Erkenntnisse teilen und zum Nachahmen ermutigen. Mittels eines Monitoringtools werden alle Zahlen und Daten gesammelt. Zu einer richtigen Evaluierung fehlt noch der Beschluss. Es wäre "sinnvoll", heißt es aus dem Büro der Landesrätin, sei aber auch eine finanzielle Frage.
Die Modellregion wächst und lernt selbst noch, man ist erst dabei, das volle Potenzial zu entfalten. Doch eine Erkenntnis ist klar: "Beim Begriff ist Fingerspitzengefühl nötig", berichtet Andrea Dorighi von der Koordinationsstelle. "Während unsere Fachhochschüler schon nach Daten zu diversen Geschlechtern verlangen, hat man in den Gemeinden Angst vorm Binnen-I." Sie lacht, aber meint es sehr ernst. Ob man die Beipackzettel gendern wolle, sei eine oft gestellte Frage.
Solche Vorurteile zeigen, was trotz aller Erfolge und Mühen in Kärnten fehlt. Die Modellregion für Gendermedizin hat ein PR-Problem. Der eigene Instagram-Kanal zählt gerade einmal 60 Follower. Fragt man den Apotheker am Hauptplatz, eine Klagenfurterin im Bus oder sogar die Pflegeschüler der GuK, dann wissen sie nichts von der Pionierleistung ihres Bundeslandes. Kommunikationskampagnen seien zu teuer, heißt es dazu von der Koordinationsstelle, und Social Media sei auch eine Ressourcenfrage. Das Ausland mag begeistert anrufen, im eigenen Land ist der Prophet noch ungehört. Dabei lohnt der Blick nach Kärnten – auch aus dem restlichen Österreich. (Delna Antia, 6.7.2024)